Die Testierfreiheit ist ein fundamentales Prinzip des deutschen Erbrechts und ein starker Ausdruck der Selbstbestimmung jedes Einzelnen über sein Vermögen nach dem Tod. Sie gehört zu den höchsten Rechtsgütern. Jüngste Entwicklungen, insbesondere eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH), präzisieren die wenigen Grenzen dieser Freiheit. Die Verfügungsfreiheit des Erblassers ist nur in wenigen Ausnahmen eingeschränkt. Diese umfassen primär: Formvorschriften (§§ 2231 ff. BGB): Das Testament muss bestimmte formale Anforderungen (z.B. eigenhändige Niederschrift und Unterschrift) erfüllen, um zivilrechtlich wirksam zu sein. Pflichtteilsrecht (§§ 2303 ff. BGB): Nahen Angehörigen (Abkömmlinge, Ehegatten, Eltern) steht ein gesetzlicher Mindestanteil am Nachlass zu, der Pflichtteil, selbst wenn sie enterbt wurden. Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB): Das Testament ist nichtig, wenn es gegen die guten Sitten verstößt. Während das sogenannte „Geliebtentestament“ in der modernen Rechtsprechung kaum noch als sittenwidrig gilt, hat sich der Fokus auf Testamente verschoben, die Berater, Ärzte oder Betreuer begünstigen. Hier stellt sich die Frage, ob eine besondere Vertrauensstellung zur Eigennutzung missbraucht wird. Der BGH hat in einem aktuellen Urteil die zivilrechtliche Wirksamkeit solcher Testamente geklärt: Wichtige Ausnahme: Nur wenn eine Ausnutzung der Willensschwäche des Erblassers durch den Begünstigten nachweisbar ist und das Testament deshalb als sittenwidrig (§ 138 BGB) eingestuft wird, kann es für nichtig erklärt werden. Die Hürde hierfür ist jedoch hoch. Die Testierfreiheit bleibt ein hohes Gut. Das BGH-Urteil (IV ZR 93/24) bestätigt, dass berufsrechtliche Verbote (z.B. für Ärzte) keine automatische Nichtigkeit eines Testaments zur Folge haben. Der Schutzmechanismus gegen die Ausnutzung von Willensschwäche bleibt bestehen, schränkt die Selbstbestimmung des Erblassers jedoch nur in extremen Ausnahmefällen ein. 1. Die verbleibenden Grenzen der Testierfreiheit
2. Entwicklung der Sittenwidrigkeit: Berater-Testamente im Fokus
3. Schlüsselurteil des BGH zum berufsrechtlichen Zuwendungsverbot
Thema
Details
Urteil
BGH, Urteil vom 15.05.2024 (Az. IV ZR 93/24)
Sachverhalt
Eine Patientin hatte ihren langjährigen Hausarzt als Alleinerben eingesetzt.
Kernfrage
Führt das berufsrechtliche Zuwendungsverbot für Ärzte (§ 14 Abs. 7 MBO-Ärzte) automatisch zur zivilrechtlichen Unwirksamkeit des Testaments?
Entscheidung
Nein. Das berufsrechtliche Verbot ist primär disziplinarischer Natur und betrifft das Verhältnis zur Ärztekammer, nicht die zivilrechtliche Gültigkeit des Testaments.
Ergebnis
Das Testament bleibt grundsätzlich wirksam.
FAZIT
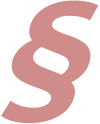
TESTIERFREIHEIT 2.0: Grenzen und aktuelle BGH-Rechtsprechung
TESTIERFREIHEIT 2.0: Grenzen und aktuelle BGH-Rechtsprechung was last modified: Oktober 17th, 2025 by