In den 1980er-Jahren war es eine Seltenheit, wenn Kinder nach der Trennung der Eltern primär beim Vater lebten. Umgangstermine waren oft kurz, sporadisch und von Vorbehalten geprägt. Heute hat sich das Bild gewandelt: Immer mehr Eltern praktizieren ein paritätisches Wechselmodell, bei dem das Kind zu gleichen Teilen bei beiden Elternteilen lebt. Gesellschaftlich ist diese Entwicklung begrüßenswert – rechtlich jedoch wirft sie neue Fragen auf. Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschluss vom 18.04.2024 – XII ZB 415/23) bringt nun Klarheit für unverheiratete Eltern und zeigt: Das Recht passt sich der gelebten Vielfalt an. Ein nichteheliches Kind lebte nach der Trennung der Eltern zu je 50 % bei Mutter und Vater. Die Mutter beantragte beim Jugendamt Unterhaltsvorschuss nach § 1612b BGB, da der Vater seiner Zahlungspflicht nicht nachkam. Das Jugendamt lehnte ab: Bei paritätischem Wechselmodell sei der Unterhaltsanspruch ohnehin saldiert, also ausgeglichen. Die Mutter argumentierte, sie vertrete das Kind allein, da sie das alleinige Sorgerecht habe (§ 1626a BGB). Der Vater widersprach: Im Wechselmodell müsse auch er als vertretungsberechtigt gelten. Für unverheiratete Eltern gilt: Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht, es sei denn, beide erklären eine gemeinsame Sorge (§ 1626a Abs. 1 BGB). Doch das Sorgerecht ist nicht gleichzusetzen mit der Vertretungsmacht in Unterhaltsfragen. Der BGH stellt klar: Auch bei alleinigem Sorgerecht der Mutter kann der Vater im Wechselmodell passiv vertretungsberechtigt sein, wenn das Kind bei ihm lebt und er faktisch Verantwortung trägt. Entscheidend ist § 1629 Abs. 2 BGB: Der nicht sorgeberechtigte Elternteil vertritt das Kind in Angelegenheiten des täglichen Lebens, solange sich das Kind mit Einwilligung des sorgeberechtigten Elternteils bei ihm aufhält. Im Wechselmodell ist der Aufenthalt des Kindes beim Vater keine „Ausnahme“, sondern regelmäßige Praxis. Damit wird der Vater zum „passiven Vertreter“ in Unterhaltsfragen – er kann Ansprüche des Kindes gegen sich selbst geltend machen. Das Problem wird akut, wenn ein Elternteil deutlich mehr verdient als der andere. Im Wechselmodell schulden beide Eltern Barunterhalt entsprechend ihrer Einkommensverhältnisse (§ 1606 Abs. 3 Satz 2 BGB). Ohne klare Vertretungsregeln könnte ein Elternteil die Unterhaltsberechnung blockieren – zum Nachteil des Kindes. Der BGH schließt diese Lücke: Der BGH zeigt, dass das Wechselmodell nicht nur ein Betreuungskonzept, sondern ein rechtliches Gesamtpaket ist. Unverheiratete Eltern müssen sich zwar weiterhin aktiv um eine gemeinsame Sorgeregelung bemühen, erhalten aber mehr Spielraum für faire Lösungen. Praxis-Tipp: Bei Streitigkeiten helfen Fachanwälte für Familienrecht, die Balance zwischen Fürsorge und Recht durchzusetzenDer Fall: Wer vertritt das Kind bei unverheirateten Eltern im Wechselmodell?
Die Rechtslage: Sorgerecht vs. Vertretungsmacht
Warum das Urteil wichtig ist: Fairness bei ungleichen Einkommen
Fazit: Ein Schritt Richtung Gleichberechtigung
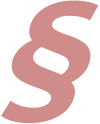
Vom Exoten zum Normalfall: Wie der BGH das Wechselmodell für unverheiratete Eltern rechtssicher macht
Vom Exoten zum Normalfall: Wie der BGH das Wechselmodell für unverheiratete Eltern rechtssicher macht was last modified: Juni 23rd, 2025 by